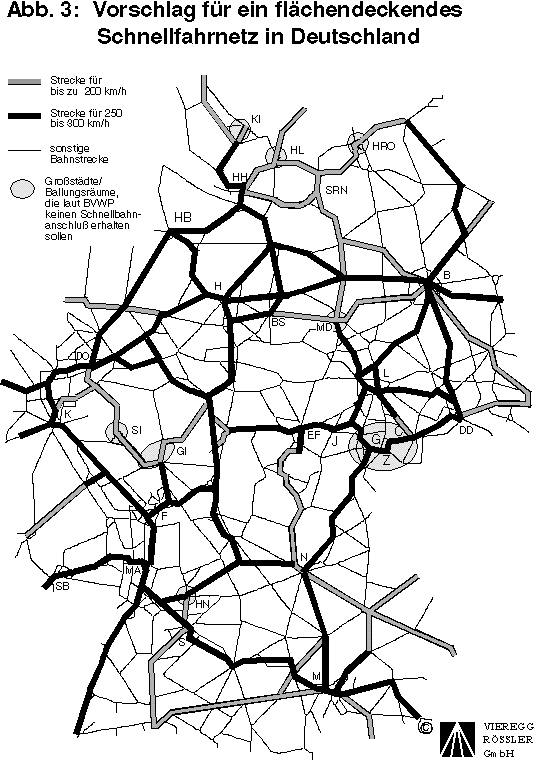Falsche Lösungsvorschläge
Vorbild Schweiz?
Bahnfahren nicht konkurrenzfähiger durch Kerosin-Steuer
Konkurrenz des Zuges gegen europaweiten Flugverkehr aussichtslos
Ersatz von Kurzstrecken-Flügen durch Züge möglich
Hauptkonkurrent: Autoverkehr
Konkurrenzfähige Preise im Bahnverkehr
Kapitalarmer Fahrweg
Kostengünstigere Züge
Konkurrenzfähige Reisezeiten im Bahnverkehr
weiter mit:
Anhang Tabellen
Bevor jedoch mögliche Lösungen zur Rettung des Schienenpersonenfernverkehrs (abgekürzt:
SPFV) vorgestellt werden, sollen zunächst einige Vorschläge und Pläne behandelt werden,
mit deren Hilfe die Eisenbahn-Unternehmen selbst oder politische Gruppierungen bislang
versuchten, mehr Personen als bisher zum Bahnfahren im Fernverkehr zu animieren.
Hierbei handelt es sich im wesentlichen um (1) Tempolimits und Maut auf Autobahnen
sowie Halbpreis-Pässe und Integrale Taktfahrpläne bei der Eisenbahn nach Schweizer
Vorbild, (2) die Forderung nach einer Besteuerung des Flugzeug-Treibstoffes
und (3) das geplante europaweite Netz von Schnellfahrstrecken. Doch diese Vorschläge
sind, auch wenn sie zum Teil bereits umgesetzt wurden, alle nicht zielführend,
was im folgenden gezeigt wird.
Mit schöner Regelmäßigkeit wird auf die Schweiz als Vorbild verwiesen, um den Marktanteil
der Eisenbahn im Personenverkehr zu erhöhen: Wer in der Schweiz eine Autobahn benutzen
will, muß zum einen Gebühren bezahlen (Autobahn-Vignette) und darf zum anderen nicht
schneller als mit Tempo 120 fahren. Zugleich verkehren fast alle Bahnen und
Linienbusse nach einem Integralen Taktfahrplan (abgekürzt: ITF): im Stundentakt
mit leicht merkbaren Abfahrtszeiten immer zur selben Minute, häufig sogar im Halbstundentakt.
Charakteristisch für den ITF ist, daß alle Züge und Busse in den Knotenbahnhöfen
zur gleichen Zeit halten, um minimale Umsteigezeiten zu garantieren. Der größte
Teil der Schweizer Bevölkerung besitzt ein Halbtax-Abonnement, das den Preis für
Bahnfahrkarten um 50% reduziert. Der angebliche Beweis für den Erfolg dieser Maßnahmen:
Jeder Schweizer fährt pro Jahr im Durchschnitt um über 1.000 km mehr mit dem Zug
als jeder Deutsche.
Doch bei dieser Argumentation wird entweder vergessen oder sogar bewußt verschwiegen,
daß jeder Schweizer im Jahresdurchschnitt um fast 2.000 km mehr mit dem Auto
fährt und eine um 2 km länger Strecke mit dem Flugzeug zurücklegt als jeder Deutsche,
und das in der viel kleineren Schweiz mit ihren wesentlich kürzeren Entfernungen
(siehe Tab. 7). Die Schweizer sind also, wie meist lobend hervorgehoben wird, zwar
"Weltmeister im Bahnfahren", aber vermutlich sind sie erst recht "Weltmeister
im Autofahren", und dies trotz Autobahn-Gebühren, Tempolimits auf Autobahnen und
der meist nie erwähnten Tatsache, daß in der Schweiz viele wichtigen Straßen
monatelang wegen Schnee und Eis unpassierbar sind. Und die Schweizer dürften, wenn
nicht "Weltmeister", so doch zumindest "Europameister im Fliegen" sein, obwohl
ihnen durch Halbtax-Abonnement und ITF das Bahnfahren angeblich so schmackhaft
gemacht wird.
Naturschutz-Organisationen und Teile von Bündnis 90 / Die Grünen, aber auch Linke
in der SPD und viele Eisenbahn-Freunde, behaupten mit großer Selbstverständlichkeit,
daß der Flugverkehr innerhalb von Deutschland und Europa nur deshalb eine
so große Rolle spiele und so stürmische Wachstumsraten zeige, weil der Flugzeug-Treibstoff
- anders als Benzin und Dieselkraftstoff im Straßen- und Eisenbahnverkehr - nicht
besteuert wird. Wenn eine Kerosin-Steuer eingeführt würde, müßten die Fluggesellschaften
zwangsläufig die Preise für die Tickets drastisch anheben, so daß Bahn-Fahrkarten,
relativ betrachtet, deutlich billiger würden. Dadurch finde endlich eine Verkehrsverlagerung
vom Flugzeug hin zum Zug statt.
Richtig ist zweifellos, daß die Besteuerung des Flugzeug-Treibstoffs längst überfällig
ist, um endlich eine Gleichbehandlung aller Personen-Verkehrsmittel zu erreichen
und um dem defizitären Staatshaushalt eine Einnahmequelle zu eröffnen, die laut Angaben
von Robin Wood e.V. jährlich 7 Milliarden DM in die leeren Kasse des Bundes einbringen
würde  .
.
Aber es ist keineswegs zu erwarten, daß durch eine solche Kerosin-Steuer die Flugtickets
auf den relativ kurzen Strecken innerhalb von Westeuropa und besonders im innerdeutschen
Luftverkehr auch nur um einen einzigen Pfennig teurer werden. Denn die Kosten,
die pro Flug anfallen, werden nur zu einem geringen Teil durch den Treibstoff-Verbrauch
verursacht. So beträgt der Kostenanteil des Kerosins bei einem durchschnittlichen
innereuropäischen Flug nur rund 7%, während beispielsweise Start- und Landegebühren
mit rund 24% wesentlich stärker ins Gewicht fallen  . Würde der Flugzeug-Treibstoff
mit einer Mineralölsteuer von 200% belegt, was eine Verdreifachung der Treibstoff-Kosten
bedeuten würde, so würde der Treibstoff gerade 17% der Kosten eines typischen
Fluges in Europa verursachen.
. Würde der Flugzeug-Treibstoff
mit einer Mineralölsteuer von 200% belegt, was eine Verdreifachung der Treibstoff-Kosten
bedeuten würde, so würde der Treibstoff gerade 17% der Kosten eines typischen
Fluges in Europa verursachen.
Um diese relativ geringe Kostensteigerung aufzufangen, gibt es mehrere Möglichkeiten,
beispielsweise die Abschaffung der kostenlosen Bordverpflegung oder die Absenkung
der relativ hohen Start- und Landegebühren auf das deutlich niedrigere Niveau der
USA.
Viele Politiker, nationale Bahnverwaltungen, Hersteller von Zügen und große Baufirmen
propagieren, für den schnellen Schienenverkehr ein europaweites Netz zu bauen,
das beispielsweise von Paris über Berlin bis Moskau reichen soll. Auch wenn
die erwähnte Langzeitprognose  zum gegenteiligen Ergebnis kommt, wird dennoch behauptet,
daß mit einem solchen Hochgeschwindigkeits-System der wachsende innereuropäischen
Personen-Fernverkehr vom Flugzeug auf den Zug verlagert würde.
zum gegenteiligen Ergebnis kommt, wird dennoch behauptet,
daß mit einem solchen Hochgeschwindigkeits-System der wachsende innereuropäischen
Personen-Fernverkehr vom Flugzeug auf den Zug verlagert würde.
Am Beispiel des Teilabschnitts Berlin - Moskau kann gezeigt werden, wie aussichtslos
hier der Konkurrenzkampf des TGV oder ICE gegen das Flugzeug wäre: Heute benötigt
der Moskwa-Express, der einzige durchgehende Zug pro Tag, für die rund 1.900
km langen Strecke von Berlin nach Moskau 27 Stunden 17 Minuten. Durch den Bau
einer Schnellfahrstrecke für durchgehend 300 km/h (Investitionskosten: über 20
Mrd. DM) könnte die Fahrzeit auf rund 8 Stunden verkürzt werden  . Doch schon heute
dauert ein Flug zwischen Berlin und Moskau nur 2 Stunden 40 Minuten und ist
somit um über 5 Stunden schneller als eine mögliche Fahrt mit dem TGV oder ICE in
frühestens 20 Jahren.
. Doch schon heute
dauert ein Flug zwischen Berlin und Moskau nur 2 Stunden 40 Minuten und ist
somit um über 5 Stunden schneller als eine mögliche Fahrt mit dem TGV oder ICE in
frühestens 20 Jahren.
Aber selbst ein realitätsnahes Projekt wie die Komplettierung der TGV-Strecke von
Paris über Lyon bis Marseille ist äußerst fragwürdig, wenn es darum geht, mit dem
Zug gegen das Flugzeug antreten zu wollen. Nach Fertigstellung des noch im Bau
befindlichen Abschnitts Lyon - Marseille ("TGV Méditerranée") und der Totalsanierung
der TGV-"Altstrecke" Paris - Lyon soll der 750 km lange Schienenweg von Paris Gare-de-Lyon
nach Marseille St-Charles mit durchgängig Tempo 300 in nur noch 3 Stunden bewältigt
werden. Doch für die rund 650 km lange Luftlinie Paris - Marseille benötigt
das Flugzeug nur gut 1 Stunde. Auch bezüglich des Preises wird der TGV vermutlich
nicht mithalten können, wenn am 1.4.2000 innerhalb der EU die letzte Stufe der
Liberalisierung des Luftverkehrs in Kraft tritt. Das bedeutet, daß dann auch
Airlines aus dem Ausland mit deutlich niedrigeren Flugpreisen als bisher den französischen
Markt bedienen dürfen, dessen Fluggast-Potential bisher nur zu einem geringen
Teil ausgeschöpft wird.
Ganz anders ist die Marktsituation bei Distanzen bis zu ungefähr 350 km (siehe Tab.
4 im Teil I). So will die Lufthansa ihre Kurzstrecken-Flüge von Düsseldorf,
Köln/Bonn und Stuttgart nach Frankfurt (Main) einstellen, sobald die ICE-Strecke
Köln - Rhein/Main in Betrieb genommen wird. Dann dauert nämlich die Fahrt beispielsweise
von Düsseldorf nach Frankfurt per Zug keineswegs mehr länger als die Flugreise
inkl. Anfahrt zum Flughafen, Check-in, Warten, Flug und schließlich Weiterfahrt
in die Frankfurter City. Aber auch wer bislang mit einem Zubringer-Flug den Frankfurter
Flughafen erreicht, um in ein Langstrecken-Flugzeug umzusteigen, kann zukünftig
im ICE nach Frankfurt-Flughafen Fernbahnhof anreisen. Insgesamt werden so pro Tag
rund 30 Flüge entfallen, was jedoch die Zahl der Starts und Landungen in Frankfurt
bei täglich rund 1.100 Flugbewegungen um nicht einmal 3% verringert. Aber
dieser Effekt dürfte deutlicher ausfallen, wenn auch andere Airlines dem Beispiel
der Lufthansa folgen und wenn auf weiteren innerdeutschen Relationen die Kurzstrecken-Flüge
eingestellt werden. Vor allem wird dann die Zahl der ICE-Fahrgäste im Umkreis
von rund 350 km um Frankfurt drastisch ansteigen.
Ein Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse im europäischen Personenverkehrs-Markt
zeigt, daß das Flugzeug ohnedies nicht der Hauptkonkurrent für den Zug ist. Denn
der Anteil des Flugverkehrs im Verkehrsmarkt der EU ist, bezogen auf das Jahr
1997, mit 6,7% ähnlich klein wie der Anteil der Eisenbahn, der 5,8% beträgt. Auch
Bus, Tram und U-Bahn erbringen mit zusammen 9% nur einen geringen Teil der Verkehrsleistungen.
Dagegen entfällt der Löwenanteil im Personenverkehr auf das Auto, dessen Marktanteil
1997 bei 78,5% lag  . Da der Autoverkehr schon ab einer Entfernung von 150 km/h
bezüglich der Haus-zu-Haus-Reisezeit einem echten Schienen-Schnellverkehr mit Luftlinien-Geschwindigkeiten
um 180 km/h unterlegen ist, eröffnen sich hier für den SPFV große Chancen.
. Da der Autoverkehr schon ab einer Entfernung von 150 km/h
bezüglich der Haus-zu-Haus-Reisezeit einem echten Schienen-Schnellverkehr mit Luftlinien-Geschwindigkeiten
um 180 km/h unterlegen ist, eröffnen sich hier für den SPFV große Chancen.
Die DB Reise & Touristik favorisiert bislang in ihrem Angebot den ICE-Zug, der in
der Regel nur in Großstädten hält, wobei der "ideale" ICE-Haltebahnhof anscheinend
in Metropolen mit Verkehrsflughäfen liegt. Dagegen wird der IR-Verkehr, der
auch kleinere Städte an den schnellen Schienenverkehr anbindet, eher als "zweite
Wahl" betrachtet und sogar immer weiter eingeschränkt. Doch wenn nun der Autoverkehr
und nicht mehr der Flugverkehr als Konkurrent gilt, ist eine veränderte Angebots-Strategie
im SPFV notwendig: Gleichrangig zum ICE-Verkehr ist ein Zugsystem erforderlich,
das mit derselben Qualität (komfortable Waggons, Stundentakt, hohe Geschwindigkeit)
gezielt die Räume zwischen den Großstädten erschließt. Dieses Angebot kann
beispielsweise weiter den Namen "InterRegio" tragen.
Für ein solches gleichwertiges Zugsystem zusätzlich zum ICE-Angebot sind Hochgeschwindigkeits-Triebwagen
mit einem Beschleunigungsvermögen notwendig, das ähnlich hoch wie bei den heutigen
S-Bahn-Triebwagen der Baureihe 420 ist. Nur auf diese Weise ist gewährleistet,
daß die relativ große Zahl von Zwischenhalten, die zur flächenhaften Erschließung
des gesamten Bundesgebietes unverzichtbar ist, nicht zu Fahrzeit-Verlängerungen
führt.
Um im Konkurrenzkampf gegen das Auto erfolgreich zu sein und den SPFV vor dem Absturz
in die Bedeutungslosigkeit zu retten, müssen die geeigneten Wege bzw. Mittel
gewählt werden. Und die richtigen Heilmittel, die nur gemeinsam wirken, heißen
"Konkurrenzfähige Preise" und "Konkurrenzfähige Reisezeiten" im Bahnverkehr.
Im Teil I war bereits die Ursache genannt worden, weshalb bislang die Preise für
das Bahnfahren nicht konkurrenzfähig sind: "Die hohen Fahrpreise der Bahn sind Ausdruck
bzw. Folge der hohen Kosten, mit denen die Verkehrsleistungen im SPFV produziert
werden. Diese Produktionskosten kommen in erster Linien durch die hohen Fahrwegkosten
der Bahn zustande."  Zur Senkung der Fahrpreise ist es also vor allem notwendig,
die Kosten der Eisenbahn-Infrastruktur drastisch zu reduzieren. Um im Marktsegment
SPFV die erforderlichen Preissenkungen überhaupt durchzusetzen, muß der Wettwerb
zwischen mehreren Anbietern möglich werden. Schließlich sind noch Kostensenkungen
bei der Beschaffung und beim Betrieb der Züge zu nennen.
Zur Senkung der Fahrpreise ist es also vor allem notwendig,
die Kosten der Eisenbahn-Infrastruktur drastisch zu reduzieren. Um im Marktsegment
SPFV die erforderlichen Preissenkungen überhaupt durchzusetzen, muß der Wettwerb
zwischen mehreren Anbietern möglich werden. Schließlich sind noch Kostensenkungen
bei der Beschaffung und beim Betrieb der Züge zu nennen.
Der Schienenverkehr besitzt einen sehr aufwendigen Fahrweg, in dem sehr viel - vermutlich
unnötig viel - Kapital gebunden ist. Besonderes Augenmerk gilt hierbei den folgenden
Komponenten, die im Straßenverkehr weitgehend und im Luftverkehr völlig fehlen:
Tunnels, Talbrücken, tiefe Einschnitte und hohe Dämme, ortsfeste Signale auf
relativ hohen Masten sowie Elektrifizierung mit Oberleitungen. Durch innovative
Trassierungsprinzipien und die Anwendung des modernsten Stands der Fahrzeug-,
Antriebs- und Signaltechnik kann beim Bau neuer Bahnstrecken auf diese kapitalintensiven
und somit preistreibenden Bauwerke und Strecken-Ausrüstungen ganz bzw. weitgehend
verzichtet werden. Wenn die Sanierung bestehender Bahnlinien, insbesondere der
Signalanlagen und Fahrleitungen, erforderlich ist, kann gleich die modernste,
kostengünstigere Technik verwendet werden.
Landschafts-angepaßte Trassen
Datenübertragung per Funk statt ortsfeste Signale
Fahrdrahtlose Energieversorgung
Eingleisige Schnellfahrstrecken
Kostensenkung um bis zu Faktor 10 - Voraussetzung für Wettbewerb auf Gleisen
weiter mit:
Kostengünstigere Züge
Beim Strecken-Neubau lassen sich die kostenintensiven Tunnels, Talbrücken, Einschnitte
und Dämme, die für die deutschen Neubaustrecken so charakteristisch sind,
auf ein Minimum reduzieren, indem sich die Trasse der Landschaft anpaßt. Dazu ist
es notwendig, größere Steigungen und zugleich engere Kurven als bei den bisherigen
neuen ICE-Trassen zu realisieren. Steigungen von 4% sind möglich, wenn auf
den neuen Bahnlinien keine schweren Güterzüge verkehren, sondern ausschließlich
leichte Personenzüge in Form von Triebwagen, die über eine Vielzahl von angetriebenen
Achsen verfügen. Sind diese Triebwagenzüge, entsprechend dem heutigen Stand
der Technik, mit Neigetechnik ausgerüstet, so können im Vergleich zu herkömmlichen
Strecken engere Kurven gebaut werden, ohne daß die Geschwindigkeit gegenüber
den bisherigen Starrzügen reduziert werden muß. Selbst für Tempo 300 genügen dann
noch Kurven mit einem Radius von rund 2,3 km, während die Schnellfahrstrecken
Hannover - Würzburg und Mannheim - Stuttgart, auf denen die starren Züge der 1.
und 2. ICE-Generation mit 250 bis maximal 280 km/h verkehren, Kurven mit Mindestradien
von 5,1 km aufweisen.
Ein wichtiger Kostenblock, der beim heutigen Stand der Technik entbehrlich ist, stellt
die Streckenausrüstung mit verkabelten, ortsfesten Signalen und festen Blockabschnitten
dar. An die Stelle dieser beim Bau und Unterhalt sehr aufwendigen und zugleich
im Betrieb äußerst störanfälligen Signaltechnik tritt der "Funkbasierte Fahrbetrieb",
bei dem alle relevanten Informationen per Funk in die Führerstände der Züge übertragen
werden  . Diese Datenübertragung per Funk ist zugleich die Voraussetzung für den
"wandernden Block", bei welchem sich der nachfolgende Zug allein an der Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Zuges orientiert, dem er im Bremsweg-Abstand folgen darf.
Dieses zeitgemäße Sicherungssystem baut auf computergestützten Berechnungen der
jeweils zulässigen Geschwindigkeit und einem ständigen Datenaustausch zwischen
Zug und Computer auf und läßt ein Vielfaches an Zügen zu, verglichen mit dem althergebrachten
Blocksystem. Die innovative und wirtschaftlich sehr erfolgreiche britische
Eisenbahn-Gesellschaft Virgin Rail läßt derzeit ihre Intercity-Strecken zwischen
London und Glasgow bzw. Edinburgh mit der genannten funkgestützten Signaltechnik
ausrüsten, um die Kapazitäten dieser 2-Gleis-Strecken drastisch zu erhöhen
. Diese Datenübertragung per Funk ist zugleich die Voraussetzung für den
"wandernden Block", bei welchem sich der nachfolgende Zug allein an der Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Zuges orientiert, dem er im Bremsweg-Abstand folgen darf.
Dieses zeitgemäße Sicherungssystem baut auf computergestützten Berechnungen der
jeweils zulässigen Geschwindigkeit und einem ständigen Datenaustausch zwischen
Zug und Computer auf und läßt ein Vielfaches an Zügen zu, verglichen mit dem althergebrachten
Blocksystem. Die innovative und wirtschaftlich sehr erfolgreiche britische
Eisenbahn-Gesellschaft Virgin Rail läßt derzeit ihre Intercity-Strecken zwischen
London und Glasgow bzw. Edinburgh mit der genannten funkgestützten Signaltechnik
ausrüsten, um die Kapazitäten dieser 2-Gleis-Strecken drastisch zu erhöhen  .
Andernfalls müßten diese Strecken eine Vielzahl zusätzlicher Blocksignale erhalten,
was hohe Kosten verursachen würde.
.
Andernfalls müßten diese Strecken eine Vielzahl zusätzlicher Blocksignale erhalten,
was hohe Kosten verursachen würde.
Alle Eisenbahn-Schnellfahrstrecken und die meisten sonstigen Bahnmagistralen in Europa
zeichnen sich dadurch aus, daß die Gleise mit Fahrdrähten überspannt sind,
entlang der Strecke zahlreiche Unterwerke zur Transformation der Strom-Spannung
liegen, Hochspannungsleitungen den Strom über große Entfernungen transportieren
und Kraftwerke zur Erzeugung des Bahnstroms vorhanden sind. Auf diese umständliche
Weise werden die Lokomotiven und Triebwagen mit der Antriebsenergie versorgt.
Die hierfür benötigte technische Ausrüstung ist ähnlich kapitalintensiv und störanfällig
wie die genannte herkömmliche Signaltechnik. Die Konkurrenten Auto und Flugzeug
kommen hingegen ganz ohne eine derartige externe und aufwendige Energieversorgung
aus, obwohl sie mit ähnlich hohen und zum Teil sogar wesentlich höheren Geschwindigkeiten
als Züge verkehren.
Antrieb mit Gasturbinen
Strom aus Wasserstoff-Brennstoffzellen
weiter mit:
Eingleisige Schnellfahrstrecken
Doch für den Antrieb von Zügen im Hochgeschwindigkeits-Verkehr gibt es eine Alternative,
nämlich die Gasturbinen-Technik, die in den USA und Kanada weiter optimiert wird.
Denn in beiden nordamerikanischen Ländern will man bei zukünftigen Eisenbahn-Schnellfahrstrecken,
die alle relativ geringe Zugzahlen aufweisen werden, die hohe Kapitalbindung
durch die Strecken-Elektrifizierung vermeiden. Lediglich die Strecke von Washington
über New York bis Boston wurde inzwischen komplett elektrifiziert, da hier
im dicht besiedelten Nordost-Korridor eine so hohe Zahl von Zügen verkehrt wie sonst
nirgends in Nordamerika.
Sehr wenig bekannt ist im übrigen die Tatsache, daß der französische TGV ursprünglich
mit Gasturbinen ausgerüstet und somit fahrdrahtlos betrieben werden sollte.
Allerdings wurde nur ein einziger TGV-Prototyp mit dieser Antriebstechnik ausgestattet.
Dieser Testzug legte während seines Einsatzes von 1972 bis 1978 eine Gesamtstrecke
von über 50.000 km mit einer Geschwindigkeit von mindestens 200 km/h und fast
2.000 km mit 300 km/h und mehr zurück. Allerdings wurde der Serien-TGV dann als
herkömmlicher elektrischer Zug gebaut, vermutlich um die großen Überschüsse an
Atomstrom aus französischen Kernkraftwerken zu "verheizen".
Kurz nach der Jahrtausendwende wird eine zweite Alternative zum herkömmlichen elektrischen
Betrieb einsatzreif sein, nämlich Wasserstoff-Brennstoffzellen, welche den Fahrmotoren
die benötigte elektrische Energie liefern und sozusagen Kraftwerke im fahrenden
Zug darstellen. Damit der Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht,
brauchen die Lokomotiven bzw. Triebwagen entsprechend dimensionierte Tanks, deren
Volumen jedoch keineswegs größer als das der heutigen Tanks beim Dieselantrieb
sein wird. Mehrere Automobilhersteller, allen voran Daimler-Chrysler und Ford,
arbeiten mit Hochdruck an dieser Technologie, die bis 2005 serienmäßig in Pkws
eingebaut werden soll. Erste Linienbusse sind bereits mit dieser innovativen Technik
im Alltags-Einsatz. Eisenbahn-Gesellschaften in den USA und in Kanada rüsten diesel-elektrische
Lokomotiven auf die Energieversorgung mittels Wasserstoff-Brennstoffzellen um. Dagegen
scheinen sich die europäischen Bahnen noch nicht in diese Richtung zu bewegen.
Bei schwachem Verkehrsaufkommen, wie beispielswiese auf der ICE-Strecke (Würzburg
- ) Rohrbach - Fulda mit nur einem Zug pro Stunde und Richtung, reicht ein Streckengleis
vollkommen aus. Die Zugkreuzungen finden hier problemlos in den 2-Gleis-Abschnitten
südlich Rohrbach und nördlich Fulda statt, denn beim 1-Stunden-Takt ergibt
sich nur alle 30 Minuten eine Zugbegegnug. In diesem Zeitraum legt ein Zug mit
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 km/h genau 100 km zurück, so daß theoretisch
alle 100 km ein relativ kurzer 2-Gleis-Abschnitt genügt. Bei einem 30-Minuten-Takt
und Tempo 200 wird alle 50 km ein relativ kurzes Stück 2-Gleis-Strecke benötigt,
falls sich hier nicht ohnedies ein mehrgleisiger Bahnhof befindet, in welchem
die Züge beider Richtungen anhalten.
Wenn alle genannten Einsparpotentiale beim Bau von Eisenbahnstrecken genutzt werden
- landschafts-angepaßte Trassen, keine ortsfesten Signale mehr, fahrdrahtlose
Energieversorgung, eingleisige Schnellfahrstrecken -, so können die Investitionskosten,
die bisher in Deutschland bei rund 40 Mio DM pro Strecken-Kilometer lagen, auf
ca. 4 Mio DM pro km reduziert werden. Ohne also den Nutzen zu schmälern, sind somit
Einsparungen um bis zu Faktor 10 möglich  .
.
Eine derart gravierende Senkung der Fahrwegkosten ist die Voraussetzung dafür, daß
die Gebühren für die Trassenbenutzung entsprechend reduziert werden. Dagegen sind
bislang - zumindest in Deutschland - die Trassenpreise pro Zug sehr hoch. Dies
führt dazu, daß im deutschen SPFV bislang nur Züge der DB Reise & Touristik auf
den Gleisen verkehren, die im Besitz von DB Netz sind, aber keine andere Betreiber-Gesellschaft
zum Zug kommt. Somit besteht das ursprünglich vorhandene Monopol der DB, das
durch die Bahnreform eigentlich abgeschafft werden sollte, im SPFV de facto weiter.
Wenn jedoch aufgrund reduzierter Fahrwegkosten und entsprechend niedrigerer
Trassenpreise auch andere Anbieter die Chance erhalten, eigene Züge im SPFV einzusetzen,
entsteht endlich Konkurrenz auf den Schienen. Als Konsequenz daraus werden die
Fahrpreise ähnlich stark fallen wie während der letzten Jahre die Preise für das
Telefonieren. Dadurch entsteht in der Bevölkerung ein hoher Anreiz, im Fernverkehr
mit dem Zug statt mit dem Auto zu fahren.
Ein weiteres, ungenutztes Einsparpotential besteht bei der Beschaffung und beim Betrieb
der Fahrzeuge im SPFV, so daß die Produktionskosten, bezogen auf den einzelnen Sitzplatz,
gesenkt werden können. Hierfür gibt es gleich mehrere Ansatzpunkte, nämlich Kauf
der Züge bei ausländischen Herstellern, bedarfsgerechte Zuglängen, Fahrpreis-Gestaltung
entsprechend den zeitlichen Nachfrage-Schwankungen und Verdopplung der Sitzplatz-Anzahl
pro Waggon.
Kauf der Züge bei preisgünstigen ausländischen Herstellern
Bedarfsgerechte Zuglängen
Differenzierte Fahrpreise entsprechend den zeitlichen Nachfrage-Schwankungen
Verdopplung der Sitzplatz-Anzahl pro Waggon
weiter mit:
Konkurrenzfähige Reisezeiten im Bahnverkehr
Kürzlich wurde bekannt, daß innerhalb der DB AG Überlegungen im Gange sind, nur die
fest bestellten 14 Garnituren des Hochgeschwindigkeits-Zuges ICE 3 von den deutschen
Firmen ADtranz und Siemens zu beziehen, während die Mehrzahl der ICE-3-Züge bei
ausländischen Firmen zu deutlich geringeren Preisen beschafft werden könnte. Diese
Diskussion wurde durch die Absicht der beiden deutschen Hersteller ausgelöst,
den Verkaufspreis pro Zug drastisch anzuheben. Ohnedies ist bekannt, daß der Preis
für den französischen TGV, der von der Firma Alstom in Frankreich gebaut wird,
deutlich niedriger ist als der Preis des ICE 1. Beide Beispiele zeigen, daß durch
den Kauf von Zügen für den SPFV bei preisgünstigen ausländischen Anbietern
die Fahrzeug-Kosten stark reduziert werden können. Bisher war es hingegen in Deutschland
üblich, die Schienen-Fahrzeuge im Fernverkehr allein von deutschen Hochpreis-Herstellern
zu beziehen.
Bei den langen Zugläufen, wie sie im SPFV üblich sind, orientiert sich die Sitzplatz-Kapazität
pro Zug meist an dem Streckenabschnitt mit der stärksten Nachfrage. Auf diese
Weise wird eine Überfüllung der Züge in den hoch belasteten Teilstrecken vermieden.
Doch dieses Verfahren hat den großen Nachteil, daß in den Abschnitten mit geringer
Nachfrage der Zug fast leer durch die Gegend fährt. Ein Beispiel für einen Zuglauf
mit extrem unterschiedlicher Auslastung bietet die IC-Linie Dresden - Leipzig
- Magdeburg - Hannover - Dortmund - Köln - Frankfurt (Main) - Würzburg - Nürnberg
- Passau. Die Kosten einer solchen Zugfahrt mit abschnittsweise vielen ungenutzten
Sitzplätzen müssen zwangsläufig auf die wenigen Fahrgäste umgelegt werden. Als
Alternative bietet es sich an, die Sitzplatz-Kapazität eines Zuges an der Teilstrecke
mit der niedrigsten Nachfrage auszurichten. Für Abschnitte mit höherem Fahrgastaufkommen
gibt es in diesem Fall mehrere Lösungen: zusätzliche Züge einzusetzen, den betreffenden
Zug um mehrere Waggons zu verstärken oder einen weiteren Zugteil anzukuppeln, was
bei den ICE-Zügen ab der 2. Generation kein Problem darstellt.
Ähnlich wie im räumlichen Verlauf einer Zugfahrt entstehen auch Nachfrage-Schwankungen
im zeitlichen Ablauf. So sind Fernzüge am Morgen und am Spätnachmittag stärker
besetzt als um die Mittagszeit und am späten Abend. Am Freitagnachmittag und
am Sonntagabend entstehen regelmäßig die größten Auslastungs-Spitzen. Dasselbe
gilt beim Beginn und Ende von Schulferien, besonders in den Sommermonaten, sowie
vor und nach Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Dagegen ist die Nachfrage
im SPFV während des trüben Monats November am geringsten. Durch eine Staffelung
der Fahrpreise entsprechend der unterschiedlichen Nachfrage kann eine eher gleichmäßige
Auslastung der Züge erreicht werden, so daß weniger "Geisterzüge" bzw. "Geisterwaggons"
verkehren müssen  . Fahrgäste, die an keinen bestimmten Termine gebunden sind,
haben dann die Möglichkeit, gezielt zu Billigpreis-Zeiten zu verreisen und somit
ihre persönlichen Fahrtkosten stark zu reduzieren.
. Fahrgäste, die an keinen bestimmten Termine gebunden sind,
haben dann die Möglichkeit, gezielt zu Billigpreis-Zeiten zu verreisen und somit
ihre persönlichen Fahrtkosten stark zu reduzieren.
Insgesamt führt eine differenzierte Preisgestaltung und eine nachfrage-gerechte Bemessung
der Kapazität jedes Zuges dazu, daß die durchschnittlichen Kosten pro Sitzplatz
sinken, weil die Auslastung steigt. Zu bedenken ist, daß bisher die IC- und ICE-Züge
in Deutschland im Durchschnitt lediglich zu rund 50% besetzt sind, während
der Auslastungsgrad im Flugverkehr bei 65 bis 75% liegt - auch eine Ursache der
niedrigen Flugpreise.
Durch eine Veränderung der Inneneinrichtung von IR-, IC- und ICE-Waggons ist eine
ähnlich dichte Bestuhlung möglich, wie sie in Kleinwagen, Reiseomnibussen und Flugzeugen
üblich ist. Bekanntlich leiden diese eng-bestuhlten Verkehrsmittel keineswegs
unter mangelnder Nachfrage - ganz im Gegenteil. Deshalb ist es durchaus vorstellbar,
pro Waggon 26 Sitzreihen mit jeweils 5 Plätzen vorzusehen, wobei sich auf der
einen Seite des Mittelgangs 2 und auf der anderen Seite 3 Sitzplätze befinden.
Somit ergeben sich je Wagen 130 Plätze. Auf diese Weise kann die Kapazität eines
ICE-1-Waggons, die heute in der 2. Klasse bei 66 Plätzen liegt, fast verdoppelt
werden. Gegenüber dem heutigen IR-Wagen mit nur 60 Plätzen in der 2. Klasse ist
sogar eine Steigerung um 117% möglich. Da die Investitions- und Betriebskosten
nicht höher sind als bei einem herkömmlichen Wagen, können die Fahrpreise in etwa
halbiert werden. Selbstverständlich sollten weiterhin auch Waggons mit einer
großzügigeren Bestuhlung für Fahrgäste der 1. bzw. 2. Klasse und den entsprechenden
Fahrpreisen verkehren. Die Wagen mit 130 Plätzen bilden die im Teil I erwähnte
3. Klasse und schaffen ein Niedrigpreis-Angebot für Personen, die sonst ihre
Reise mit einem engen, billigen Kleinwagen, Bus oder Flugzeug machen würden und
somit als Kunden für den SPFV verloren wären.
Fast so wichtig wie konkurrenzfähige Preise ist das Kriterium "Konkurrenzfähige Reisezeiten
im Bahnverkehr". Hiermit ist keineswegs allein die Fahrzeiten zwischen zwei Bahnhöfen
des Fernverkehrs gemeint, sondern der gesamte Zeitaufwand vom Startpunkt der Reise
bis zum endgültigen Ziel. Diese Haus-zu-Haus-Reisezeit setzt sich zusammen aus
der Zeit für den Weg zum Einstiegsbahnhof, der Wartezeit bis zur Abfahrt, der
Fahrzeit im Zug sowie der Zeit für den Weg vom Ausstiegsbahnhof zum eigentlichen
Reiseziel. Alle diese Reisezeit-Phasen gilt es zu verkürzen.
Kurze Zu- und Abgangszeiten, keine Wartezeiten
Neigezüge als Standard-Fahrzeuge
Anhebung der Geschwindigkeit auf Flachlandstrecken
Flächendeckendes Hochgeschwindigkeits-Netz
weiter mit:
Anhang Tabellen
Um kurze Zugangszeiten zu den Startbahnhöfen und ebenso kurze Abgangszeiten von den
Zielbahnhöfen bis zum endgültigen Reiseziel zu erreichen, ist ein optimaler Zubringer-
und Abbringerverkehr durch die Eisenbahn-Unternehmen zu organisieren. Dazu gehört
zum einen die Integration von Taxifahrten in die Haus-zu-Haus-Transportkette
und zum anderen die bestmögliche Erschließung der Fernbahnhöfe durch Buslinien,
Trambahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Nahverkehrszüge oder Regionalzüge. Da die genannten
Öffentlichen Nahverkehrsmittel in den Ballungszentren nach einem dichten Fahrplantakt
verkehren, entstehen hier beim Übergang zum Eisenbahn-Fernverkehr kaum Zeitverluste.
Doch außerhalb der Zentren und insbesondere in ländlichen Räumen ist eine optimale
Vernetzung von Fern - und Nahverkehr durch den bereits beschriebenen Integralen
Taktfahrplan notwendig, der zumindest jede Stunde kurze Umsteigezeiten garantiert.
Eine solche nahtlose Transportkette von Haus zu Haus ist eine wichtige Voraussetzung
dafür, daß keine nennenswerten Wartezeiten entstehen, die als besonders unangenehm
empfunden werden. Eine zweite Voraussetzung, um Wartezeiten zu vermeiden, besteht
darin, daß alle Reisenden über die Abfahrtszeiten der Züge im Startbahnhof und
- falls notwendig - über die Abfahrtszeiten aller Zubringer-Verkehrsmittel umfassend
informiert sind. Um diesen Informationsstand tatsächlich zu erreichen, benötigt
jeder Haushalt in Deutschland einen kostenlosen Fahrplan, der alle Zugabfahrten
"seines" Bahnhofs enthält.
Züge mit Gleisbogenabhängiger Wagenkastensteuerung, besser bekannt als "Neigezüge",
bilden inzwischen den Stand der Technik. Indem sich die Wagenkästen zur Kurveninnenseite
hin neigen, können solche Züge in engen Kurven bei gleichem Fahrkomfort mit
einer um 30 bis 40% höheren Geschwindigkeit als die herkömmlichen, starren Züge
fahren. Neigezüge werden inzwischen mit über 200 km/h bis maximal 250 km/h in Italien,
Schweden, Finnland und ab Herbst 1999 auch in den USA eingesetzt. In Deutschland
verkehrt inzwischen der ICE-T, dessen Höchstgeschwindigkeit allerdings auf 230 km/h
begrenzt ist. Der ICE 3, der ab 2000 zum Einsatz kommen und Tempo 300 erreichen
soll, verfügt zwar nicht über die Gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung,
aber es besteht die Option zum nachträglichen Einbau dieser innovativen Technik.
Man kann davon ausgehen, daß die Neigetechnik bis 2020 der Standard bei allen Zügen
des SPFV sein wird. Auf den vorhandenen deutschen Schnellfahrstrecken werden
dadurch noch einmal drastische Fahrzeit-Gewinne erzielt. So kann beispielsweise
die Fahrzeit Frankfurt Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe, die vor Beginn der Sanierungsarbeiten
an der "Neubau"-Strecke Fulda - Kassel bei 80 Minuten lag und heute 84 Minuten beträgt,
durch ICE-3-Neigezüge auf 55 Minuten reduziert werden - ideal für den ITF. Voraussetzung
hierfür ist allerdings die Komplettierung der noch fehlenden Schnellfahr-Abschnitte
zwischen Frankfurt und Fulda.
Auf den geradlinigen Hauptstrecken in der norddeutschen Tiefebene, im Münsterland,
im Ruhrgebiet, am Oberrhein sowie im süddeutschen Flachland ist die Geschwindigkeit
der Züge meist auf 160 km/h und auf einigen sog. Ausbaustrecken auf 200 km/h
beschränkt. Dieses Tempolimit ist angesichts der fast kurvenlosen Trassierung
nicht zu rechtfertigen. Allerdings verlangen bestimmte Vorschriften diese Geschwindigkeits-Obergrenze
auf bestehenden, modernisierten Strecken, da hier der Abstand zwischen zwei Streckengleisen,
von Gleismitte zu Gleismitte gerechnet, "nur" 4,00 m beträgt. Erst bei einem
größeren Gleisabstand, wie er auf den deutschen Neubaustrecken mit 4,70 m gegeben
ist, darf die Geschwindigkeit mehr als 200 km/h betragen.
In Großbritannien haben die Streckengleise einen Gleismitten-Abstand von 3,42 m.
Dieser enge Gleisabstand wurde selbst dann nicht vergrößert, als auf der Strecke
London - Edinburgh der Intercity-Verkehr mit einer Maximalgeschwindigkeit von 225
km/h aufgenommen wurde. Da die Waggons des hier verkehrenden Intercity 225 eine
Breite von 2,73 m haben, bleibt bei der Begegnung zweier Hochgeschwindigkeits-Züge
nur noch ein Zwischenraum von 69 cm übrig, was in England aus aerodynamischen
Gründen für ausreichend erachtet wird. In Deutschland dagegen, wo die Breite
der Mittelwagen des ICE 1 und ICE 2 bei 3,02 m liegt, entsteht bei der Begegnung
zweier Züge bei einem Gleisabstand von 4,00 m ein relativ großer Zwischenraum
von 98 cm, der also um 29 cm breiter ist als beim britischen Schnellverkehr. Dennoch
ist in Deutschland auf derartigen Bahnstrecken nur Tempo 200 zulässig.
Realistischerweise ist davon auszugehen, daß überall dieselben aerodynamischen Gesetze
gelten, so daß auch in Deutschland ein Abstand von 69 cm für zwei Züge ausreicht,
die sich mit jeweils Tempo 225 begegnen. Deshalb müßte es eigentlich auf deutschen
Altstrecken möglich sein, angesichts des wesentlich größeren Zwischenraums bei
zwei sich begegnenden ICE-Zügen die Geschwindigkeit bis 250 km/h zu erhöhen, sofern
der Gleisabstand 4,00 m beträgt. Somit kann auf einer zusätzlichen Länge von
Tausenden von Kilometern ein echter Hochgeschwindigkeits-Verkehr stattfinden
(siehe Abb. 3).
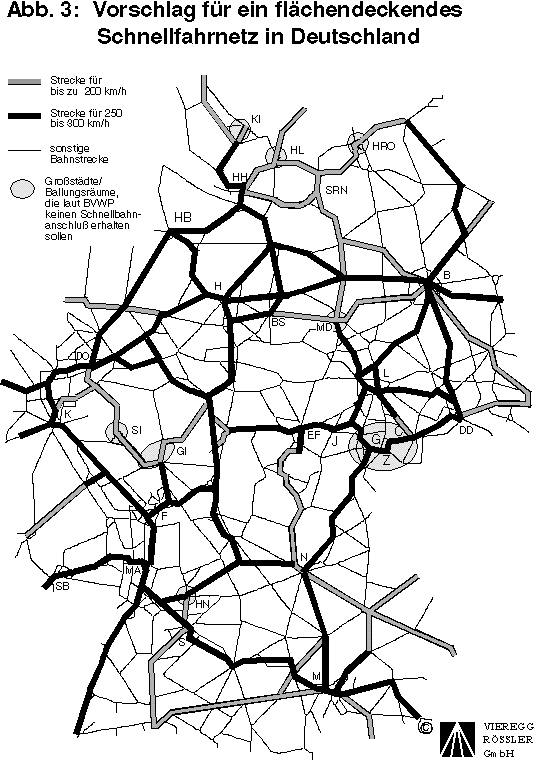
In den Korridoren mit hohem Potential für den SPFV, aber ungünstig trassierten Bahnlinien,
beispielweise in den Räumen Heilbronn und Gera/Zwickau/Chemnitz, sowie in mehreren
deutschen Urlaubsgebieten, ist der Neubau von Strecken unumgänglich. Zusammen
mit den bereits bestehenden Schnellfahrstrecken und den genannten Flachlandstrecken,
die für Tempo 250 zu ertüchtigen sind, ergibt sich so ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeits-Netz
für den Schienenverkehr, das mit dem längst vorhandenen Hochgeschwindigkeits-System
des Autoverkehrs endlich wettbewerbsfähig ist. Dieses deutschland-weite Schnellfahrnetz
der Eisenbahn ist in Abb. 3 dargestellt.
Wenn auch in den übrigen EU-Staaten und in der Schweiz ein ähnlich dichtes Netz für
echten Schienen-Hochgeschwindigkeits-Verkehr entsteht, kann der SPFV seinen Marktanteil
auf Kosten des bislang dominierenden Autoverkehrs stark ausweiten und somit zu
einem bedeutenden Verkehrsträger werden. Bleibt es jedoch bei der bisherigen Verkehrspolitik
und bei der jetzigen Strategie der meisten Eisenbahn-Unternehmen in Europa, nur einige
wenige, aber extrem teure Schnellfahrstrecken zu bauen, dann ist der SPFV
vor dem endgültigen Absturz in die Bedeutungslosigkeit nicht mehr zu retten.




 .
.





 .
.
 . Würde der Flugzeug-Treibstoff
mit einer Mineralölsteuer von 200% belegt, was eine Verdreifachung der Treibstoff-Kosten
bedeuten würde, so würde der Treibstoff gerade 17% der Kosten eines typischen
Fluges in Europa verursachen.
. Würde der Flugzeug-Treibstoff
mit einer Mineralölsteuer von 200% belegt, was eine Verdreifachung der Treibstoff-Kosten
bedeuten würde, so würde der Treibstoff gerade 17% der Kosten eines typischen
Fluges in Europa verursachen.
 zum gegenteiligen Ergebnis kommt, wird dennoch behauptet,
daß mit einem solchen Hochgeschwindigkeits-System der wachsende innereuropäischen
Personen-Fernverkehr vom Flugzeug auf den Zug verlagert würde.
zum gegenteiligen Ergebnis kommt, wird dennoch behauptet,
daß mit einem solchen Hochgeschwindigkeits-System der wachsende innereuropäischen
Personen-Fernverkehr vom Flugzeug auf den Zug verlagert würde.
 . Doch schon heute
dauert ein Flug zwischen Berlin und Moskau nur 2 Stunden 40 Minuten und ist
somit um über 5 Stunden schneller als eine mögliche Fahrt mit dem TGV oder ICE in
frühestens 20 Jahren.
. Doch schon heute
dauert ein Flug zwischen Berlin und Moskau nur 2 Stunden 40 Minuten und ist
somit um über 5 Stunden schneller als eine mögliche Fahrt mit dem TGV oder ICE in
frühestens 20 Jahren.
 . Da der Autoverkehr schon ab einer Entfernung von 150 km/h
bezüglich der Haus-zu-Haus-Reisezeit einem echten Schienen-Schnellverkehr mit Luftlinien-Geschwindigkeiten
um 180 km/h unterlegen ist, eröffnen sich hier für den SPFV große Chancen.
. Da der Autoverkehr schon ab einer Entfernung von 150 km/h
bezüglich der Haus-zu-Haus-Reisezeit einem echten Schienen-Schnellverkehr mit Luftlinien-Geschwindigkeiten
um 180 km/h unterlegen ist, eröffnen sich hier für den SPFV große Chancen.
 Zur Senkung der Fahrpreise ist es also vor allem notwendig,
die Kosten der Eisenbahn-Infrastruktur drastisch zu reduzieren. Um im Marktsegment
SPFV die erforderlichen Preissenkungen überhaupt durchzusetzen, muß der Wettwerb
zwischen mehreren Anbietern möglich werden. Schließlich sind noch Kostensenkungen
bei der Beschaffung und beim Betrieb der Züge zu nennen.
Zur Senkung der Fahrpreise ist es also vor allem notwendig,
die Kosten der Eisenbahn-Infrastruktur drastisch zu reduzieren. Um im Marktsegment
SPFV die erforderlichen Preissenkungen überhaupt durchzusetzen, muß der Wettwerb
zwischen mehreren Anbietern möglich werden. Schließlich sind noch Kostensenkungen
bei der Beschaffung und beim Betrieb der Züge zu nennen.
 . Diese Datenübertragung per Funk ist zugleich die Voraussetzung für den
"wandernden Block", bei welchem sich der nachfolgende Zug allein an der Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Zuges orientiert, dem er im Bremsweg-Abstand folgen darf.
Dieses zeitgemäße Sicherungssystem baut auf computergestützten Berechnungen der
jeweils zulässigen Geschwindigkeit und einem ständigen Datenaustausch zwischen
Zug und Computer auf und läßt ein Vielfaches an Zügen zu, verglichen mit dem althergebrachten
Blocksystem. Die innovative und wirtschaftlich sehr erfolgreiche britische
Eisenbahn-Gesellschaft Virgin Rail läßt derzeit ihre Intercity-Strecken zwischen
London und Glasgow bzw. Edinburgh mit der genannten funkgestützten Signaltechnik
ausrüsten, um die Kapazitäten dieser 2-Gleis-Strecken drastisch zu erhöhen
. Diese Datenübertragung per Funk ist zugleich die Voraussetzung für den
"wandernden Block", bei welchem sich der nachfolgende Zug allein an der Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Zuges orientiert, dem er im Bremsweg-Abstand folgen darf.
Dieses zeitgemäße Sicherungssystem baut auf computergestützten Berechnungen der
jeweils zulässigen Geschwindigkeit und einem ständigen Datenaustausch zwischen
Zug und Computer auf und läßt ein Vielfaches an Zügen zu, verglichen mit dem althergebrachten
Blocksystem. Die innovative und wirtschaftlich sehr erfolgreiche britische
Eisenbahn-Gesellschaft Virgin Rail läßt derzeit ihre Intercity-Strecken zwischen
London und Glasgow bzw. Edinburgh mit der genannten funkgestützten Signaltechnik
ausrüsten, um die Kapazitäten dieser 2-Gleis-Strecken drastisch zu erhöhen  .
Andernfalls müßten diese Strecken eine Vielzahl zusätzlicher Blocksignale erhalten,
was hohe Kosten verursachen würde.
.
Andernfalls müßten diese Strecken eine Vielzahl zusätzlicher Blocksignale erhalten,
was hohe Kosten verursachen würde.
 .
.
 . Fahrgäste, die an keinen bestimmten Termine gebunden sind,
haben dann die Möglichkeit, gezielt zu Billigpreis-Zeiten zu verreisen und somit
ihre persönlichen Fahrtkosten stark zu reduzieren.
. Fahrgäste, die an keinen bestimmten Termine gebunden sind,
haben dann die Möglichkeit, gezielt zu Billigpreis-Zeiten zu verreisen und somit
ihre persönlichen Fahrtkosten stark zu reduzieren.